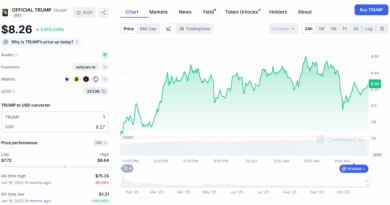“Ja, es gibt ein Problem mit Diskriminierung” – Teil II — RT DE

5 Apr. 2021 06:00 Uhr
Frau Abdallah, Sie kommen aus einer kubanischen Musikerfamilie, Ihr Vater ist aus Trindad und Tobago, Sie wurden 1983 in London geboren und 1998 zog Ihre Familie nach Frankfurt am Main. Nach einer Schauspielausbildung in Berlin folgten verschiedene Theater-Engagements. Sie haben unter anderem in der TV-Serie “Wie geht deutsch? – Ein Ratgeber für Migranten” mitgespielt und waren mit “Sauerkraut und Kochbananen” auf Tournee. Mit Christine Prayon sind Sie als Duo “Schwarz auf Weiß” aufgetreten, um “gängige Klischees und Vorurteile” ad absurdum zu führen oder um die Frage, wer “hier eigentlich der Ausländer” ist, wie das Theaterhaus Stuttgart schrieb, zu klären. Nun sind Sie ja schon als Kind nach Deutschland gekommen. Neben Spanisch und Englisch sprechen Sie auch Hessisch oder Schwäbisch und spielen trotzdem häufig die Ausländerin und Migrantin. Warum und warum sind Sie nicht Frau Huber, Müller oder Schmid von nebenan? Wird nicht gerade dadurch ein gängiges und latent diskriminierendes Klischee auch im 21. Jahrhundert immer weiter bedient?
Ich habe eine Figur, die Frau Müller heißt. Frau Müller ist eine höchst rassistische Hessin, die “mit Ausländern gut kann”, es immer nett meint, aber nicht anders kann, als an ihren Fingern zu riechen, wenn sie einen Menschen angefasst hat, der “wo ganz anders herkommt”. Warum ich das erwähne: Die weiße Mehrheitsgesellschaft ist Frau Müller. Obwohl sich unserer Gesellschaft dahingehend in Bewegung befindet, ist sie noch nicht soweit zu erkennen, dass ihre Vorstellung von einer rassismusfreien Gesellschaft viel mehr dieser Figur entspricht, als sie denken.
Eine Dalila Abdallah als Regina Schneider im Fernsehen zu sehen, sprengt jegliche Vorstellungskraft und nicht nur das, es steht im Widerspruch zu den Klischees, die sie kennen. Denn Frau Müller meint es ja nicht böse. Frau Müller hat begriffen, dass nun auch hier in Deutschland Menschen leben, die nicht von hier sind. Sie hat auch begriffen, dass einige von ihnen Kinder und Kindeskinder in diesem Land haben, doch sie hält an dem Fakt fest, dass diese Menschen anders sind. Also solange Frau Müller und ihre Enkel mich als etwas Anderes sehen, werde ich ihre diskriminierenden Klischees auch im 21 Jahrhundert bedienen müssen. Frau Müller ist stellvertretend für die Frau an der Supermarktkasse, die überrascht ist, wie gut ich deutsch spreche, für den Mann an der Bar, der mir von seinem Auslandssemester in Kenia erzählt, und für die Filmemacher, die sich beim besten Willen nicht vorstellen können, dass jede Figur in ihrem Film auch schwarz sein könnte, ohne beispielsweise eine Geflüchtete zu sein.
Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie in Ihrem Beruf mit Diskriminierung gemacht?
Die poetischste Geschichte von Diskriminierung in meinem Beruf war folgende: Ich war wieder mal arbeitslos und brauchte dringend einen Job. Obwohl ich nichts von dem Format hielt, habe ich mich für eine schlecht bezahlte Kindermärchen-Tournee beworben. Ich hatte mich sehr gut vorbereitet, denn ich wollte, nein, ich brauchte diesen Job. Ich kam, sah, siegte und ließ die Jury, zu der ich vier Stunden gereist war, mit offenstehenden Mündern klatschend und ein Jurymitglied sogar weinend ihre Kritik vortragen. Die Kritik war ausschließlich positiv. Der Chef der Jury sagte sogar, er hätte diese sehr beliebte Rolle schon mehr als 200-mal im Vorsprechen gesehen und meine Darbietung sei die beste, die er je gesehen hat. Für mich war das damit eine sichere Nummer: Ich hatte den Job und konnte mich entspannen. Als sich alle von der Euphorie erholt hatten, sagte mir der Chef-Juror: “Du bist sehr gut, das weißt du ja, aber wir haben leider keine schwarzen Rollen.” Als ich darauf reagieren wollte, sagte er weiter: “Ich weiß, das ist doof, aber wir müssten unsere Stücke komplett umschreiben, um zu erklären, warum du schwarz bist.” Er fing an zu kichern, “und ich glaube, die Kinder würden sich echt hart fürchten vor dir, wenn du unsere Prinzessin spielen würdest”. Ich bin damals die vier Stunden mit dem Zug wieder heimgefahren, und das Verrückte ist: Ich hatte sogar Verständnis und habe ihm tatsächlich auf mindestens einer Ebene zugestimmt. Heute sehe ich das natürlich anders, ich würde das so nicht mehr hinnehmen. Ich warte aber auch nicht mehr auf das Verständnis der Besetzer und schreibe meine eigenen Stücke, der kann mich mal!
Waren Erlebnisse wie dieses ausschlaggebend, sich seit 2014 für die Initiative “Respekt! Kein Platz für Rassismus” zu engagieren oder wie wurden Sie zur Botschafterin dieser Initiative und worum geht es dabei?
Zur Botschafterin für “Respekt! Kein Platz für Rassismus” wurde ich, weil der Gründer mich damals angesprochen hatte. Es war ursprünglich ein Projekt, das der Bekämpfung von Rassismus auf Fußballplätzen dienen sollte, daher stammt das “Platz” im Slogan. Das Konzept wurde dann ausgeweitet und ich war direkt Feuer und Flamme dafür.
Der Rassismus ist im Sport so präsent wie eh und je und sehr viel direkter und unmittelbarer als der Alltagsrassismus, dem wir jeden Tag begegnen. Die Initiative setzt sich mittlerweile aber nicht nur gegen Rassismus auf dem Platz ein, sondern bekämpft ihn überall da, wo er sichtbar ist in der Gesellschaft. Tolle Sache.
Rassismus ist noch immer ein tiefer sitzendes Problem, wie man auch an der Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern in den USA oder in Europa immer wieder feststellen muss. Gibt es eine strukturelle Diskriminierung vor und hinter der Kamera auch an deutschsprachigen Sets und Bühnen und wenn ja, weshalb ist das Ihrer Meinung nach so?
Rassismus ist ein globales Problem, und solange sich hauptsächlich die Betroffenen damit beschäftigen und nicht die Täter und Untätigen, wird es immer ein strukturelles Problem bleiben. Gerade hier in Hessen hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Rassismus, dessen Aufklärung die schwarz-grüne Landesregierung nicht als notwendig ansieht. Da die Film- und Theaterbranche ein Teil dieses ganzen Systems ist, muss ich ganz klar sagen: Ja, es gibt ein Problem mit Diskriminierung in unserer Branche. Die Gewerkschaft der Schauspieler, der BFFS – Bundesverband Schauspiel, arbeitet vor dem Hintergrund der Black-Lives-Matter-Bewegung daran, unsere Branche für das Thema zu sensibilisieren. Das Problem liegt aber immer noch an Redakteuren, Regisseuren, Produzenten und Autoren, die glauben, dass ein nicht-weißer Cast auch kein Geld einbringt, obwohl es genügend Gegenbeispiele gibt. Sie glauben, dass die Erzählungen von Nicht-Weißen nur eine Minderheit interessiere. Wir brauchen aber mehr Farben – im Theater, im Fernsehen und hinter den Kulissen. Erst dann werden Blickwinkel gezeigt, die erstens die Realität abbilden und zweitens den Menschen als komplexes Wesen zeigen.
Die Wirklichkeit ist selten schwarz und weiß, obwohl dieses Bild besonders von der Filmindustrie in Hollywood vermittelt wird. Hauptdarsteller werden häufig von weißen Menschen mit westlichen Namen und makellosem Körper gespielt, womit ja nicht nur ein oberflächliches Schönheitsideal vermittelt wird. Betrifft die Diskriminierung im Film neben Hautfarben also noch Religionen, Ethnien oder Körpermaße und bedient eine womöglich koloniale und imperialistische Weltanschauung? Wie ist Ihre Wahrnehmung, wenn Sie etwa an Filmproduktionen aus dem globalen Norden über Afrika denken, in denen die Weißen gerne die Lehrer, die Retter und Helfer, die Zivilisierten und Moralapostel oder schlicht die Herrscher spielen oder täuscht mich dieser Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht nicht. Die wenigen Ausnahmen mal beiseite, herrscht nach wie vor ein eurozentristischer Blickwinkel in den Erzählweisen in Film und Fernsehen. Eine Produktion wie Black Panther wird zum Politikum und das lediglich, weil die Helden schwarz sind. Ich finde, das spricht Bände. Die schwarze Person stirbt nicht mehr zuerst und das sollen wir dann als Erfolg betrachten? Aber das Phänomen des eurozentristischen Blicks geht weit darüber hinaus.
“Colorism” spielt hier eine große Rolle. Zu selten werden Frauen als “Love Interest” gezeigt, die dunkle Haut haben. Viola Davis hat Hale Berry abgelöst, aber sie wird nie als “Schönheit” gelten. Wann wird es normal sein, etwa eine Frau mit Kopftuch zu besetzen und das Kopftuch oder ihre Herkunft nicht zuerst als figurbeschreibend zu sehen? Das sind Themen, von denen wir als Gesellschaft noch sehr weit weg sind. Ich selbst ertappe mich auch in diesen Denkmustern und muss mir oft vor Augen führen, dass wir als Gesellschaft noch einen steinigen Weg vor uns haben, wenn wir diese schrecklichen Prägungen abwerfen wollen. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist: Wie viel Gleichheit braucht es, um anders sein zu dürfen?
Wie lässt sich das erklären und was sagt das über den Film und seine Rolle in der Gesellschaft, aber auch über das Kräfteverhältnis zwischen Produzenten und Akteuren aus? Oder anders gefragt: Ist die westliche Filmbranche die Propaganda des westlichen Kolonialismus, damals wie heute?
Produzenten und Redaktionen sind immer noch die, die Macht darüber haben, welches Bild wir sehen. Geld als Motivation spielt natürlich eine große Rolle, aber das Image und die Idylle der Vergangenheit auch. Es werden offensichtlich Bilder produziert, die diese alten Sichtweisen reproduzieren. Schichten, Ethnien, Berufsgruppen, Geschlechter und Religionen bekommen gewisse Zuschreibungen, und an diesen Stereotypen hat sich nur wenig geändert. Diese Klischees versucht beispielsweise Tyler Perry mit seiner Produktionsfirma aufzubrechen. Er versucht, die Zuschreibungen für Schwarze in der amerikanischen Gesellschaft zu verändern. Denn wenn man es schafft, Nicht-Weißen das Recht des Individuums zuzusprechen, das Weiße schon seit Beginn ihrer Erzählungen genießen, dann geht das Konzept nicht mehr auf. Dann kauft der Zuschauer nicht mehr diese Lügen und Klischees (“die sind ja so”) ab, und die Filmbranche würde endlich ihrem gesellschaftsbildenden Auftrag nachkommen.
Es gibt die Kritik, die wichtigsten Filmpreise der Welt wären zu weiß oder zu wenig divers und der Oscar überflüssig. In Hollywood reagiert man auf die Vorwürfe und möchte für das Jahr 2023 neue Regeln einführen, um mehr Gleichberechtigung und Integration vor und hinter der Kamera zu fördern. Was halten Sie davon und wäre das auch ein Vorbild für den deutschen Film oder welche Veränderungen wären außer starrer Quoten Ihrer Meinung nach notwendig und wünschenswert, um Diskriminierung in der Gesellschaft, aber speziell auch im Film zu bekämpfen?
Ich glaube, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich “too little, too late”, aber hey, im Moment nehmen wir auch Krümel. Veränderung ohne Quoten wäre utopisch. Das Bewusstsein ist geweckt und Schwarze, Indigene, eben alle “People of Color” wollen die volle Teilhabe, die ihnen zusteht. Keiner wartet mehr auf den Zuspruch oder die Anerkennung. Wir machen es jetzt selbst, wie es schon immer der Fall war: Mit Musik, mit Mode, mit Haaren und letztlich mit Körperidealen wird auch in der Filmbranche der Mainstream bunt werden. Sie haben uns in rund 400 Jahren Sklaverei nicht klein bekommen. Seht, was wir schaffen, wenn wir keine Ketten tragen!
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Flo Osrainik.
Mehr zum Thema – “Wir sind hier und wir sind viele”: 185 deutsche TV-Stars outen sich