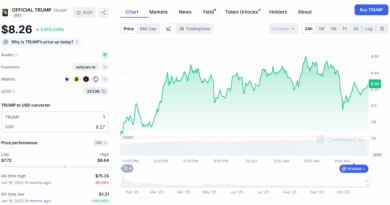“Imperativ der Aufmerksamkeit” – Teil 2 — RT Deutsch
Die neunte Anhörung der Stiftung Corona-Ausschuss behandelte die Rolle der Medien in der Corona-Krise. Neben einem Blick auf die Situation in Schweden und die Berichterstattung darüber ging es um grundlegende Fragen zur Organisation der Medien in Deutschland.
In seiner neunten Sitzung behandelte die Stiftung Corona-Ausschuss die Rolle der Medien in der Corona-Krise. Erklärtes Ziel der Ausschussarbeit ist es, die Corona-Maßnahmen der Regierungen von Bund und Ländern zu untersuchen und einer öffentlichen sowie rechtlichen Bewertung zugänglich zu machen.
Dafür kamen die Juristen des Ausschusses zu einer mehrstündigen Anhörung am 13. August in Berlin zusammen. Es berichteten der Psychologe und Journalist Patrick Plaga über die Lage in Schweden und die dortige wie internationale Berichterstattung über das skandinavische Land und dessen weniger strikten Kurs in der Corona-Krise (Teil I), der Kommunikationswissenschaftler und Medienforscher Prof. Michael Meyen sowie der Medienwissenschaftler Prof. Johannes Ludwig über die Situation der Medien und deren Berichterstattung in Deutschland, bei der es um grundlegende strukturelle und organisatorische Aspekte und ihren Einfluss auf die journalistische Arbeit ging (Teil II und Teil III).
Unterstützt wurde der Ausschuss auch in dieser Sitzung vom Lungenarzt und Epidemiologen Dr. Wolfgang Wodarg, der maßgeblich zur Aufklärung der Vorgänge rund um die sogenannte “Schweinegrippe” im Jahr 2009 beitrug und heute den Umgang mit der “Corona-Krise” kritisiert. Er selbst war dazu bereits als Experte in der ersten Ausschusssitzung ausführlich befragt worden.
Anlass dieser Anhörung ist dem Ausschuss zufolge die Diskrepanz zwischen der Realität, die die gängigen Medien mit ihrer Berichterstattung in Wort und Bild vom Geschehen in der Corona-Krise darstellen, und den verfügbaren zahlreichen Informationen zu Fakten, Statistiken und Stellungnahmen, die dieser vorherrschenden medialen Darstellung widersprechen.
Mehr zum Thema – Worte, Zahlen, Bilder, “Nachrichten” – zur “verlässlichen Faktenlage” in der Corona-Krise
Anhörung – Die Rolle der Medien
BERICHT DES KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTLERS UND MEDIENFORSCHERS PROF. MICHAEL MEYEN
Aus historischer und soziologischer Perspektive stünden für ihn mehr die Strukturen als die Psyche des einzelnen Handelnden im Vordergrund, um zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Das würde ja bedeuten, wir müssen nur die Person eines Amtsleiters austauschen, eines Chefredakteurs, eines Menschen, der zu einer Pressekonferenz geht, und dann würde es irgendwie anders werden – das würde ich eher nicht so sehen.
Die Frage des Vertrauens in die Medien sei wissenschaftlich nicht gut untersucht und über Umfragen schwer zu ermitteln. So könne diese Frage etwa bedeuten, ob man dem Wetterbericht, den Fußballergebnissen oder den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vertraue.
Entscheidender sei für ihn die Definitionsmacht der sogenannten Qualitäts- beziehungsweise Leitmedien.
Die Leitmedien definieren eine Realität, die man nicht ignorieren kann. Die Leitmedien sagen uns, was wir für Realität halten müssen. Wenn wir also die Tagesschau anschalten oder die Süddeutsche Zeitung lesen oder auch die Bild-Zeitung kaufen, dann beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse. Wir beobachten, wer es schafft, seine Version der Realität in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir können diese Version nicht ignorieren. Wir können sie bei Strafe des Untergangs nicht ignorieren, weil wir annehmen müssen, dass die anderen die gleiche Version der Realität wahrgenommen haben und ihr Verhalten entsprechend ausrichten werden.
Daher sei die Frage, ob ich der Tagesschau oder der Süddeutschen Zeitung vertraue, eigentlich irrelevant. Schließlich müsse ich das, was dort als Realität vermeldet wird, in mein Verhalten einbauen. Hier liege auch der wichtigste Unterschied zu sozialen Medien wie YouTube-Kanälen. Man könne und müsse bei solchen Kanälen nicht unterstellen, dass sie von allen gesehen werden, weshalb man sie ignorieren könne. Das gelte für die Tagesschau nicht. Wenn die Tagesschau jeden Tag die Zahl der registrierten “Neuinfektionen” melde, dann müsse man dies für Realität halten. Es sei auch mit einem Signal verbunden, dass dies der Teil der Realität sei, der für einen wichtig sei.
Wenn in einer Münchner Lokalzeitung steht, dass Polizisten auf einem Bahnhof einen Menschen mitgenommen haben, der keine Maske aufhatte und sich geweigert hatte, nach Aufforderung eine aufzusetzen, dann ist das ein doppeltes Signal: Zum einen, Maskeaufsetzen ist wichtig, sonst würde das die Zeitung nicht melden. Es würde nicht in der Zeitung stehen, wenn es nicht ein wichtiges Thema wäre. Und zum anderen, wenn ich mich weigere, die Maske aufzusetzen, dann werde ich bestraft. Dann werde ich von der Polizei mitgenommen und muss möglicherweise ein paar Stunden in Gewahrsam verbringen.
Das sei die Definitionsmacht, über die die Leitmedien weiterhin verfügten. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass diese Definitionsmacht unvermindert groß sei. Die Rede vom “Ende der Leitmedien” angesichts der Konkurrenz neuer sozialer Medien beziehungsweise digitaler Plattformen treffe so nicht zu.
Zugleich habe man auch erlebt, dass die Leitmedien in Deutschland ihren Auftrag “Öffentlichkeit” nicht erfüllen. Eine Verständigung zwischen den unterschiedlichen Interessen und Meinungen in einer Gesellschaft sei nur möglich, wenn diese alle die Gelegenheit hätten, in der Öffentlichkeit präsent zu sein – insbesondere ohne dass die Wertung beziehungsweise Abwertung gleich mitgeliefert werde.
Wenn man sich dann anschaut, was die Leitmedien in den vergangenen Monaten gemacht haben, dann sieht man, dass nur ein Teil dieser Interessen und Meinungen so präsent war, dass wir uns als Bürger ein Urteil bilden konnten. Viele Dinge waren nicht präsent. Was dann vielleicht wieder zu einem Vertrauensverlust führt.
Die Aufgabe eines Journalismus sei es, uns als Bürger über die unterschiedlichen Interessen und Meinungen in der Gesellschaft zu informieren, sodass wir uns eine eigene Meinung bilden können.
Und diese Auftrag wird nicht erfüllt. Und nicht aus psychologischen Gründen, sondern aus strukturellen Gründen. Die können wir benennen.
So habe Dr. Wolfgang Wodarg auf den Einfluss von Wirtschaft und Politik hingewiesen. Ein Teil der Medien in Deutschland sei nach wirtschaftlichen Interessen organisiert, wie etwa die Privatmedien und die Internetgiganten. Ein Teil sei als öffentlich-rechtliche Medien dem Diktat der Politik unterworfen. Dort existierten zwar Rundfunkräte, doch seien wir als Bürger nicht präsent.
Da kontrolliert die Politik die Journalisten. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Eigentlich sollte der Journalismus die Politik kontrollieren. Was wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, ist eine Kontrolle des Journalismus durch die Politik. Die Chefposten, die wichtigsten Posten in den Rundfunkanstalten werden von politisch dominierten Gremien, von den Rundfunkräten besetzt.
Der heutige Journalismus unterscheide sich von dem zu Zeiten eines Hanns Joachim Friedrichs, der den Anspruch formulierte, dass sich Journalismus mit keiner Sache gemein mache. Damals sei der Journalismus anders organisiert gewesen.
Heute würde ich von einem Imperativ der Aufmerksamkeit sprechen.
Dies liege vor allem an den entstandenen symbiotischen Beziehungen des Journalismus mit den digitalen Plattformen. Diese seien einerseits eine Konkurrenz, die es zur Zeit von Friedrichs nicht gegeben beziehungsweise in den Kinderschuhen gesteckt habe. Während die digitalen Plattformen damals keine ernst zu nehmenden journalistischen Mitbewerber gewesen seien, konkurrierten deren professionell gemachte Angebote heute um unsere Zeit als Nutzer. Um sein Publikum zu erreichen, könne der Journalismus nicht mehr so sein wie zu Friedrichs’ Zeiten. Andererseits seien die digitalen Plattform wie YouTube, Twitter, Instagram oder Facebook mittlerweile die wichtigsten Ausspielwege für journalistische Produkte.
Das heißt, dass der Journalismus, so wie wir ihn heute haben, sich an die Logik der digitalen Plattformen anpassen muss, wenn er überhaupt noch wahrgenommen werden will.
Die Art der Realität, die beispielsweise in Sendungen der Tagesschau oder Tagesthemen der 1980er-Jahre konstruiert worden sei, sei im Vergleich zu heute eine völlig andere. Heute gebe es in den Nachrichten viel weniger Politik beziehungsweise eine ganz andere Art von Politik, die auf Konflikte zwischen Personen ausgerichtet sei:
Drosten gegen Streeck. Söder gegen Laschet. Alle gegen Bodo Ramelow. Als der mal vorsichtig darüber nachdenkt, vielleicht in Thüringen, wo es so gut wie keine Fälle gibt, diese Masken abzulehnen.
Darüber hinaus sehe man permanent Superlative und Rekorde. Die Realitätskonstruktion mittels gemeldeter Fallzahlen in den Nachrichtensendungen wie der Tagesschau mache angesichts der tatsächlichen Bedeutung dieser Zahlen im Verhältnis zu einer Gesamtbevölkerung von über 80 Millionen Einwohnern keinen Sinn und habe sich gegenüber den 1980er- und 1990er-Jahren komplett gewandelt.
So habe er die Berichterstattung in den zurückliegenden Jahrzehnte über Ereignisse, die sich nicht ändern, betrachtet, wie beispielsweise große Stürme mit messbaren Daten zu Opfern und Schäden. Während früher relativ neutral, “weiter hinten” und “normal nachrichtlich” darüber berichtet worden sei, glichen die heutigen Meldungen, schon bevor ein solcher Sturm komme, denen von “Untergangsszenarien”. Ebenso gehe es bei Berichten über Parteitage weniger um inhaltliche Diskussionen, sondern darum, welche Personen um welche Posten konkurrierten und wer etwa Kanzlerkandidat werde.
In der Corona-Zeit habe man “bitter lernen müssen”, dass diese Art von Journalismus die Politik vor sich her treiben könne. Das sei der zweite Punkt, den man bedenken müsse und den er “Medialisierung” nenne.
Wir beobachten, dass alle Menschen, die irgendwo Verantwortung tragen, alle Entscheidungsträger, diese Medienlogik, diesen Imperativ der Aufmerksamkeit, internalisiert haben, und alles tun, um (…) negative Berichterstattung zu unterbinden. (…) Auf der anderen Seite wird alles getan, um Entscheidungsträger in ein möglichst positives Licht zu rücken. Und dafür hat man aufgerüstet. Nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in den Regierungen, in den Ministerien.
Das Bundespresseamt beschäftige beispielsweise rund 500 “teuer bezahlte Mitarbeiter”, die nichts anderes zu tun hätten, als die Politik der Bundesregierung in ein günstiges Licht zu rücken. Bei den vergleichsweise geringen Mitteln, die in den großen politischen Redaktionen des Landes zur Verfügung stünden, entspreche dies einem “Kampf David gegen Goliath”. Die Politik schaffe es derart, unter anderem “bestimmte Begriffe durchzudrücken”. Statt psychologischer Gründe wie Angst führten mangelnde Ressourcen dazu, dass Journalisten nicht oder zumindest nicht im ersten Moment gegen Begriffe wie “Dauerwelle”, “Corona-Leugner” oder “Hygienedemos” vorgingen. Von Journalisten, die ihren Auftrag “Öffentlichkeit” ernst nähmen, könne man zwar erwarten, dass sie diese Art des “Framings” durchschauten und versuchten, eigene Begriffe zu setzen. Doch stünden dem strukturelle Zwänge entgegen.
Da muss man sich wieder den Alltag in Redaktionen, die nach kommerziellen Gesichtspunkten organisiert werden, anschauen. Wenn Geldverdienen der wichtigste Zweck ist, und der Auftrag ‘Öffentlichkeit’ nur so eine Art Abfallprodukt, dann wird gekürzt, soweit es geht.
Die jetzige Krise werde infolge der Ausfälle bei den Anzeigeneinnahmen diese Entwicklung verschärfen. Auch sei es nicht so einfach, unter den Bedingungen von “Homeoffice” oder “vom Schreibtisch aus” stündlich neue Realitäten zu schaffen, wie es die Logik der digitalen Plattformen verlange. Dies seien keine guten Voraussetzungen, um der Definitionsmacht von Regierungen, Ministerien und Unternehmen etwas entgegenzusetzen.
Ich denke, wir kommen nicht umhin, und Corona zeigt uns das, über die Organisation von Journalismus nachzudenken. Wollen wir, dass das, was wir in der Öffentlichkeit als Realität wahrnehmen, weiter nach kommerziellen Gesichtspunkten bestimmt wird, im Verlagswesen oder im Netz, oder von politischen Gesichtspunkten, wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wodarg fragte nach der Rolle von PR-Agenturen, da viele Meldungen bis in die Wortwahl gleich klingen. Inwieweit bestimmte Agenturen dafür sorgten, dass beispielsweise in Frankreich, den USA und in Deutschland dieses “Phänomen überall gleich dargestellt wird”.
Dazu gibt es Anhaltspunkte, etwa bei Twitterkampagnen, so Meyen. Doch erscheine ihm vor allem das beschriebene Ausmaß der Ressourcen, über die Regierende verfügten, als ausschlaggebend. Hierzu gehörten insbesondere professionelles Training der Entscheidungsträger durch eigene Medienberater.
Man kann sich ja nicht vorstellen, dass ein Ministerpräsident, egal ob in Bayern oder NRW zur Pressekonferenz geht und nicht alles vorher trainiert hat. Jede potenzielle Frage, die ein Journalist da stellen könnte, ist vorher durchgeprobt worden. Die Begriffe, mit denen man dort in diese Pressekonferenz geht, sind vorher abgesprochen und ausprobiert worden. Man weiß, dass Markus Söder den Begriff, den er in den Medien sehen will, so oft wiederholt, bis der Journalist ihn aufgeschrieben hat.
Sogenanntes “Framing” über solches “Politikersprech” und Begriffe wie “Corona-Leugner” und “Covidiot” wirkten über entsprechende Assoziationen auf die Wahrnehmungen des Publikums und seien Versuche, dieses in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das seien die Mechanismen, nach denen der Journalismus über den Imperativ der Aufmerksamkeit und den Einsatz von Begriffen funktioniere. Und dies gelte nicht nur für das gegenwärtige Corona-Geschehen, sondern ebenso für alle anderen Bereiche der Gesellschaft. Für ihre Anliegen setzten Spitzenkräfte etwa in Sport, Kultur und Wissenschaft in der gleichen Weise auf die öffentliche Legitimation, die in der heutigen Mediengesellschaft das zentrale Gut sei. Ohne das “Organisieren öffentlicher Legitimation” sei keine Art von Politik, kein Bauvorhaben, nichts anderes durchzusetzen – was entweder positive oder gar keine Berichte bedeute.
Deswegen wird in den Redaktionen angerufen. Deswegen werden Redakteure in Ministerien eingeladen und in bestimmte Dinge, die da passieren, eingeweiht. Wir haben eine sehr große Nähe zwischen Entscheidern und Journalisten. Das ist einmal eine Habitusnähe. (…) Man kommt aus den gleichen Milieus, war an den gleichen Universitäten, man sieht die Welt ganz ähnlich. Man muss also gar nicht groß beeinflusst werden. Schon gar nicht muss man irgendwie Druck ausüben, weil Mittelschichtmenschen mit bestimmten Ausbildungen einfach die Welt ähnlich sehen. Und dann haben wir eine Nähe, die aus Arbeitsumgang resultiert. Wenn ich auf der Pressekonferenz jeden Tag dieselben Leute sehe. Wenn ich mit denen unterwegs bin, wenn sie im Land umherfahren, dann entwickle ich Verständnis.
Sein Kollege als Medienforscher Uwe Krüger spreche hier von “Verantwortungsverschwörung”.
Der Journalist weiß, was gut ist und was schlecht ist. Er glaubt, dass er Einfluss auf die Menschen hat. Schon dadurch, dass er Realität definieren kann. Und er fängt dann an, in die Richtung Realität zu konstruieren, die er für gut hält. Also nichts gegen die Maskenpflicht. Nichts Positives über Demonstrationen gegen die Regierungsmaßnahmen, und so weiter.
Auch wenn es also Hintergrundgespräche gebe, sei es in diesem Sinne gar nicht nötig, Journalisten dazu einzuladen. Durch die Homogenität der Redaktionen speziell in den Leitmedien könnten die Politiker um Verständnis werben und auf solches hoffen. Dies sei eine indirektere Form des Einflusses als durch unmittelbare Korruption und Einwirkungen auf die Berichterstattung, wie sie in anderen Ländern existiere, etwa über die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen, die zugleich im Mediensektor aktiv seien, oder indem die Politik generell schlecht bezahlte Journalisten direkt für deren Berichterstattung einkaufe.
Die meisten Journalisten in den deutschen Leitmedien seien gut bezahlt und könnten in der Lage sein, unabhängig von solchen Einflüssen Realität zu konstruieren.
Mit Blick auf eigene persönliche Kontakte zu Journalisten in den Leitmedien stellt sich dem Ausschuss zufolge hier die zentrale Frage:
Wie kann es sein, dass jemand, der bis dahin in vielen anderen Fragen durch kritische Berichterstattung aufgefallen ist, plötzlich vollkommen auf Linie ist? Ja nicht nur das. Sondern teilweise wird mit Schaum vor dem Mund die offizielle Linie noch verschärft. Indem man über Covidioten spricht, indem man sich geradezu wütend über Leute äußert, die in der Bahn keine Maske aufhaben, ohne überhaupt nur daran zu denken, dass es auch Atteste gibt. Wie kommt das, dass das so weit geht?
Meyen sieht dafür mehrere Gründe. Zum einen liege es an der Berufsideologie im Journalismus, wonach dieser objektiv und neutral berichte, was jedoch immer eine Illusion gewesen sei. Diese Ideologie brauche eine Reform, indem man besser über Transparenz und Reflexion spreche und eigene Weltsichten sowie mögliche Interessen von Informationsgebern offenlege. Dies würde uns als Nutzern eine angemessenere Einordnung der Informationen erlauben.
Zum anderen treffe wohl in den wenigsten Fällen der Vorwurf einer tatsächlich falschen Berichterstattung zu.
Was wir eher beobachten können, ist, dass die Teile der Wirklichkeit, die eine bestimmte Haltung unterstützen, größer gemacht werden und die Teile der Wirklichkeit, die nicht zu dieser Haltung passen (…), kleiner gemacht, weggelassen oder sogar delegitimiert werden. Wenn ich noch mal auf den Auftrag ‘Öffentlichkeit’ zurückgehe, dann wäre es eigentlich der Auftrag des Journalismus, alle Positionen abzubilden und uns als Nutzern die Möglichkeit zu geben, uns selbst ein Bild zu machen. Was wir stattdessen erleben, ist, dass bestimmte Positionen delegitimiert werden von Menschen, die eigentlich gar nicht das Wissen haben können, um solche Positionen zu falsifizieren. Das haben wir am Beispiel von Herrn Wodarg erlebt. Wo Menschen, die sehr viel weniger Sachverstand mitbringen, in sehr schnell gemachten Faktenchecks behauptet haben, die Wahrheit zu kennen, anstatt einen wissenschaftlichen Streit adäquat abzubilden und möglicherweise sogar die Streitparteien an einen Tisch zu bringen. Das wäre, was der Auftrag ‘Öffentlichkeit’ verlangen würde.
Die Ressourcen seien eigentlich vorhanden, da wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit rund acht Milliarden Euro jährlich über Gebühren finanzierten. Ein Blick auf die Organisationsform der dortigen Redaktionen zeige jedoch, dass es nur noch relativ wenige Mitarbeiter mit festen Lebenszeitverträgen gebe und öffentlich-rechtliche Medienangebote von ausgelagerten Produktionsfirmen und Freiberuflern geliefert würden. Solche Unsicherheiten förderten Konformität und eine Orientierung der Mitarbeiter ohne verlässliche Arbeitsperspektiven an den jeweiligen Leitungspositionen. Diese wiederum hätten feste Verträge und würden, wie erwähnt, von Gremien besetzt, die von der Politik dominiert seien. Im Ergebnis werde politisches Wohlverhalten belohnt.
Nachzudenken sei daher über diese Organisationsform im öffentlich-rechtlichen Journalismus und eine Rückkehr zu früheren Verhältnissen wie zur Zeit Friedrichs’ mit festen Redakteuren und festen Lebenszeitverträgen, was den Journalisten die nötige Arbeitsplatzsicherheit gebe, um sich sich eine von der Redaktionslinie unabhängige Berichterstattung erlauben zu können.
Zwar könnten solche Lebenszeitanstellungen, wie er sie selbst als Universitätsprofessor mit Beamtenstatus habe, zu einem “Ausruhen auf dem Posten” führen. Doch sei dies nur in einer Minderheit der Fälle relevant, das Berufsethos überwiege. So wollten junge Journalisten Aufklärungsarbeit leisten und würden dies auch tun, wenn sie die strukturellen Möglichkeiten dazu hätten und aus dem Diktat der Aufmerksamkeitsspirale befreit wären.
Wenn ich also nicht verlange, dass sie bestimmte Klickzahlen produzieren, sondern sie auch dafür belohne, wenn sie Stücke machen, die einfach den gesellschaftlichen Diskurs vorantreiben, aber vielleicht nicht die größte Einschaltquote, die größten Klickzahlen bekommen. Wenn Sie heute in eine Printredaktion hineinschauen, dann werden ja nicht mehr nur Klickzahlen gemessen. Es wird auch gemessen, welcher Artikel dazu führt, dass Abonnements abgeschlossen werden. Welcher Artikel dazu führt, dass man wieder zu der Seite zurückkommt. Welcher Artikel auf digitalen Plattformen geteilt wird. Wer da also eine große Reichweite erreicht. Ich bin also als Journalist darauf angewiesen, um in den Augen meiner Chefs gut dazustehen, dass ich den Imperativ der Aufmerksamkeit bediene, was etwas völlig anderes ist, als den Auftrag ‘Öffentlichkeit’ zu erfüllen.
Hinzu komme die Debatte, die im Berufsstand über den sogenannten “Haltungsjournalismus” geführt werde. Wenn es also nicht mehr um die Vermittlung von Informationen, sondern von Haltungen geht, dann stellt sich ihm die Frage, inwieweit dies eine Erklärung dafür sein könnte, dass die Berichterstattung in der Corona-Krise bisweilen mit besagtem Schaum vor dem Mund erfolgt, so eines der Ausschussmitglieder.
Auch diese Diskussion um “Haltungsjournalismus” hängt laut Meyen mit den problematischen Wirkungen des Aufmerksamkeitsimperativs und der Ressourcenzwänge im kommerziellen Journalismus zusammen. So ließen sich Exklusivität und Neues, was für Aufmerksamkeit sorge, auch über Meinungsbeiträge vom Schreibtisch aus generieren, ohne zu recherchieren oder in die Wirklichkeit hinauszugehen.
Ich bin erschrocken, dass ernst zu nehmende Redaktionsleiter, führende Journalisten, diese These ernsthaft vertreten, dass wir in Richtung Haltungsjournalismus gehen könnten. Ich glaube schon, dass Journalisten auch eine Haltung haben können und sollen, und dass sie diese auch in Leitartikeln vertreten können und sollen. Aber das ist für mich als Bürger, der sich eine Meinung bilden will, viel weniger wichtig als das, was in Interessengruppen vorhanden ist, was in der Gesellschaft insgesamt diskutiert wird, was Experten zu einem bestimmten Thema zu sagen haben. Der Journalist kann kein Experte in Epidemiologie sein. Er kann kein Experte in irgendeinem anderen Thema sein. Er muss Experte in der Vermittlung dieses Gesprächs in der Gesellschaft sein. Das ist das, was er zu leisten hat.
Zurückkommend auf die Glaubwürdigkeit der Medien betonte Meyen, es gebe entsprechende Umfragen, die er methodisch für fragwürdig halte, wonach rund ein Drittel der Befragten antwortete, kein Vertrauen mehr in die Medienberichterstattung zu haben. Andererseits erlebe man, dass die Leitmedien in der Corona-Zeit nach Einschaltquoten und Nutzerzahlen an Bedeutung gewonnen hätten. In Krisenzeiten steige generell die Bedeutung von Medien, weil in solchen Situationen jede Nachricht potenziell Einfluss auf das eigene Leben haben könne. Diese Erfahrung habe er in der DDR zur Wendezeit selbst gemacht. So sei es auch in der Corona-Zeit. Ob man in den Urlaub fahren könne, was bei Grenzkontrollen, Tests oder in der Maskenfrage gelte, all diese Dinge seien unmittelbar lebensverändernd. Dies erkläre, weshalb sich die Menschen vermehrt den gängigen Medien zuwenden. Schließlich müssten sie wissen, was dort als Realität definiert werde. Und diese Realität könnten sie nicht ignorieren, weil sie unterstellen müssten, dass auch andere wie etwa die Mitarbeiter in Geschäften die gleiche Realität wahrgenommen hätten und sich daher entsprechend verhalten würden, indem sie etwa den Zutritt verweigerten, wenn man keine Maske trage.
Gemessen an den gestiegenen Nutzerzahlen als Ausdruck einer gewachsenen Bedeutung ließen sich die traditionellen Medien als Profiteure der Corona-Krise sehen. So diskutiere gegenwärtig niemand mehr, ob traditionelle Medien durch digitale Plattformen abgelöst werden könnten.
Wodarg zufolge werden durch die Medienberichterstattung viele Menschen geschädigt, sodass sich die Frage stellt, ob eine Korrektur der Medien durch andere gesellschaftliche Bereiche wie etwa der Justiz möglich ist. Dies sei nicht zuletzt der Gegenstand dieses von Juristen gegründeten Ausschusses.
Das, was er als Auftrag “Öffentlichkeit” bezeichnet, ist ganz wesentlich von der Rechtsprechung und speziell vom Bundesverfassungsgericht mitgeprägt worden, erklärte Meyen. Daher sehe er grundsätzlich die Möglichkeit, den Journalismus wieder an seinen eigentlichen Auftrag zu erinnern. Im Einzelfall sei er allerdings skeptisch, da die rechtlichen Hürden für einen Nachweis eigener Betroffenheit und Schädigung durch eine Medienberichterstattung sehr hoch seien.
Eine generelle gesellschaftliche Debatte, so wie sie die Arbeit des Corona-Ausschusses befördern wolle, sehe er als effektiver an.
Wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft fragen, welche Art von Journalismus wir haben wollen. Wollen wir diesen Journalismus haben, der die Politik vor sich her treibt? Und der oft – und das haben wir im März und April erlebt – viel radikaler als die Politiker Forderungen stellt und dann Staatskanzleien fast automatisch dazu zwingt, da mitzuziehen, indem gemeldet wird, dass dieses Bundesland jetzt schon das gemacht hat und gefragt wird: Warum machen die anderen das nicht? Österreich hat schon Masken. Warum haben wir in Bayern noch keine? (…) Wenn wir ihn [diesen Journalismus] nicht haben wollen, dann müssen wir uns fragen, was wir uns einen anderen Journalismus kosten lassen wollen.
Was macht es mit den Medienkonsumenten, die von der Berichterstattung eine Orientierung erwarten, wenn sich herausstellt, dass der PCR-Test entgegen der Behauptungen nichts über Infektionen aussagt und die Angaben über die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen gegen die Corona-Politik Anfang August in Berlin komplett falsch sind, wollte einer der befragenden Juristen wissen.
Corona spitzt lediglich eine Entwicklung zu, die schon seit 20 Jahren zu beobachten ist, so Meyen. Begonnen hätten die Zweifel an den offiziellen und leitmedialen Darstellungen mit den Vorgängen um 9/11. Fortgesetzt habe sich das dann bei der sogenannten Bankenrettung, der Griechenlandkrise, dem Geschehen in der Ukraine oder der Berichterstattung über Ostdeutschland. Diesbezüglich sei das Vertrauen in die Medien entsprechend seit Längerem erschüttert. Eine weitergehende Frage sei, ob es angesichts dessen Selbstkritik der Medien gebe.
Eine solche Selbstkritik habe er etwa bei der Berichterstattung in der Corona-Krise nicht erlebt, obwohl diese von einer anfänglichen zurückhaltenden Weise in den bis jetzt dominierenden Panikmodus umgeschlagen sei. Das Fehlen von Selbstkritik habe er auch zuvor in seinen Untersuchungen zur NSU-Berichterstattung feststellen können. Als die Dimension NSU-Skandals nicht mehr zu übersehen gewesen sei, habe es hier und da in einzelnen Beiträgen kritisches Hinterfragen der eigenen journalistischen Arbeit gegeben. Doch insgesamt seien die allermeisten Medien lediglich auf den neuen Zug aufgesprungen und hätten dann einfach anders berichtet.
Ich würde vermuten, das würde bei entsprechenden Befunden zur Testqualität, zur Gefährlichkeit dieses Virus, zu möglichen Mutationen des Virus, zu geringerer Letalität – das würde dann ganz ähnlich laufen. Die Journalisten würden sich dann, wie jetzt auch, wieder an offiziellen Quellen orientieren, würden das übernehmen, was ihnen von Bundesbehörden, von Ministerien mitgeteilt wird.
Zwar hätten sich einige in der Berichterstattung sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Doch könne für den Fall eines Kippens der leitmedialen Darstellung der Schaden für diese Medien mit dem Verweis auf einzelne kritische Stücke, die es ja auch dort gebe, begrenzt werden. Es gebe tatsächlich positive Einzelbeispiele, bei denen der Journalismus seinen Auftrag “Öffentlichkeit” erfüllt habe, und über die es ihm möglich sei, sich zumindest teilweise reinwaschen können. Dies sei eine spannende Frage.
Insgesamt sei hierbei erneut zu betonen, dass es weniger um eine echte Falschberichterstattung als solche gehe, sondern um die mediale Konstruktion einer “Wirklichkeit, die Haltung unterstützt”. Bestimmte Teile der Wirklichkeit würden hervorgehoben, andere weggelassen oder gar diskreditiert.
Wir bekommen jetzt Zahlen über registrierte Neuinfektionen. Wir bekommen in der gleichen Nachricht aber nicht den Anstieg der Tests. Wir bekommen nichts zu der Zusammensetzung der Getesteten. Das weiß ich ja als empirischer Sozialforscher. Man kann ins Feld gehen und nicht jede gewünschte Zahl, doch fast jede Zahl bekommen, wenn man einfach die Stichprobe verändert, wenn man einfach die Kriterien verändert, mit denen etwas positiv oder negativ ist. Das ist nicht so schwer. Journalisten können aber sagen: ‘Wir haben doch gesagt, 1.200 registrierte Neuinfektionen heute. Klar, wir haben andere Teile nicht gemeldet. Aber wir haben nicht falsch berichtet.’ Wir haben Kontext weggelassen. Wir haben dem Bürger nicht erlaubt, diese Zahlen einzuordnen. Wir haben Alarmismus betrieben, indem wir zum Beispiel nicht berichtet haben, wie viele Menschen im Moment noch mit nachgewiesenen Corona-Infektionen auf Intensivstationen liegen. Da könnte man ja auch eine andere Art von Realität erzeugen, die sehr viel weniger für Panik sorgt.
Ein Ausschussmitglied hakte zu der in seinen Augen definitiven Falschberichterstattung zur Anzahl der Demonstrationsteilnehmer in Berlin sowie zur Aussagekraft der PCR-Tests als Infektionsnachweis nach.
Das sind für mich jedenfalls zwei Eckdaten, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, zu erklären, wie man so schief danebenliegen kann. Außer man sagt: ‘Ich habe der Polizei vertraut.’ Was für einen Journalisten billig ist. Oder man sagt: ‘Ja, ich habe Herrn Drosten vertraut.’ Was ebenfalls billig ist. Weil jeder wissen konnte, dass da draußen noch ein Herr Wodarg, eine Frau Mölling (…) unterwegs sind, die eine andere Meinung vertreten. Wie kommt man aus dieser Klemme wieder heraus?
Es gibt im Journalismus das generelle Problem einer großen Gläubigkeit gegenüber offiziellen Quellen, bestätigte Meyen. Zwar habe es schon immer Kritiker gegeben, für die es erste Journalismuspflicht gewesen sei, allen möglichen Quellen, nur nicht den regierungsamtlichen zu vertrauen, sondern gerade diese anzuzweifeln. Doch dem wirke die Sozialisation der Journalisten entgegen.
Das sind ja Menschen, die oft Aufsteiger sind. Die plötzlich ganz nah dran sind an diesen offiziellen Institutionen. Die an der Macht ganz nah dran sind. Warum sollen die sofort anfangen, daran zu zweifeln, was ihnen der Polizeipräsident sagt, was im Polizeibericht steht, was ihnen das Innenministerium sagt, was ihnen das RKI sagt? Das ist schon ein weiter Schritt, an offiziellen Quellen zu zweifeln. Ich habe das einmal erlebt. Ich habe ja auch lange an das geglaubt, was mir mein erster Staat [DDR] so erzählt hat. Und ich habe dann erlebt, wie das in relativ kurzer Zeit zusammenbrechen konnte und was da alles letztlich nicht erzählt worden ist. Vielleicht fällt es einem dann leichter, auch offiziellen Quellen zu misstrauen. Aber wenn ich erst einmal in dieser Welt sozialisiert worden bin und in meinem eigenen Leben, weil es funktioniert, keinen Anlass habe, der Polizei oder Ministerien zu misstrauen, dann ist es nicht so leicht.
Aus den sich in der Corona-Krise offenbarenden und als Zielsetzung der Ausschussarbeit öffentlich zu diskutierenden Problemen in vielen gesellschaftlichen Bereichen könnte dann auch im Journalismus die Erkenntnis aufkommen, dass hier “grober Unfug” gemacht worden ist, resümierte der Ausschuss.
Bei einer solchen Diskussion geht es Meyen zufolge um die Zukunft und die Organisation des Journalismus. Denkbar seien Mediensysteme, die sich aus den Vorstellungen der Nutzer und speziell deren Unzufriedenheit mit den jetzigen Medien ergäben. Diese sähen vermutlich anders aus als Mediensysteme, wie sie Politiker und Medienexperten konstruierten. Das betreffe das Leitbild des Journalismus, die Verwendung von Beitragsgeldern, Aufsicht und Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie auch Bürgerbeteiligung in kommerziellen Medienunternehmen. Für diese könnten beispielsweise Lizenzen auf Zeit vergeben werden, die entzogen oder nicht erneuert würden, wenn es zu solchen wie den hier besprochenen journalistischen Fehlleistungen komme.
Mit Blick auf die Entwicklung der sogenannten alternativen Medien speziell in der Corona-Krise sei eine Unzufriedenheit sowohl aufseiten der Anbieter, die sich zum Teil infolge dieser Krise formiert und engagiert hätten wie beispielsweise der Corona-Ausschuss, als auch der Nutzer zu beobachten. Wenn kritische Experten in den Leitmedien angemessen vorgekommen wären, hätte es keine Veranlassung gegeben, sich alternativen Informationsquellen zuzuwenden.
Die Frage ist immer wieder: Realitätsdefinition. Sie können als Untersuchungsausschuss diese Interviews führen, sie können das im Netz alles wunderbar dokumentieren. Das erlangt solange keine symbolische Gewalt, solange nicht die Leitmedien darüber berichten. (…) Es kann ignoriert werden, weil niemand unterstellen muss, dass andere das auch wahrgenommen haben. Sobald sie in der Tagesschau damit sind, müsste man sich mit ihrer Arbeit beschäftigen. Sobald einer von den Menschen, die sie hier interviewen, angegriffen wird, weil er bei ihnen war, dann müsste man ja über sie berichten. Dann würde die Existenz dieses Ausschusses für alle offensichtlich sein. So existiert ihr Ausschuss nicht. Die Leitmedien definieren, was Realität ist. Solange sie da nicht vorkommen, gibt es sie nicht.
Es gebe einen Kampf um Deutungshoheit und Definitionsmacht, an dem die digitalen alternativen Plattformen beteiligt seien. Am Anstieg der Abonnentenzahlen und des Spendenaufkommens für solche Plattformen erkenne man, dass ein großer Bedarf daran vorhanden sei. Der Ausgang dieses Kampfes sei derzeit ungewiss.
Wir erlebten bereits jetzt, wie sich zwei “öffentliche Debattenräume” bildeten. Wenn es so käme, dass eine Mehrheit der Deutschen sich auf alternativen Plattformen informiere, dann wären diese Plattformen hegemonial und von den anderen Medien nicht mehr zu ignorieren. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass es Aufwand bedeute, sich jenseits der traditionellen Leitmedien im Internet zu informieren. Das setze ein relativ großes Bedürfnis danach sowie Zeit und eine gewisse Kompetenz im Finden von Informationen voraus.
Für die allermeisten Menschen ist das nicht so wichtig, dass sie Zeit und andere Dinge investieren wollen, um sich eine zweite Meinung einzuholen. (…) Es geht immer zuerst um das eigene Leben. Es geht um die eigene Gesundheit, um wirtschaftliche Dinge. Funktioniert meine Wohnung? Habe ich einen Job, mit dem ich meine Familie ernähren kann? Wenn das alles erfüllt ist, dann fange ich vielleicht an, mich auch um Pressefreiheit und die Qualität von Journalismus zu kümmern.
Insgesamt sei die zunehmende Konzentration und der Verlust an Vielfalt im traditionellen Medienbereich ein Problem. Da sich Journalisten häufig daran orientierten, was ihre Kollegen beziehungsweise andere Medien machten, verenge dies die Möglichkeiten für Einzelne, anders zu berichten und damit selbst beispielgebend für die übrigen Kollegen zu sein. Dies betreffe vor allem den Lokaljournalismus, bei dem ehemals eigenständige Redaktionen zentral zusammengelegt und in verschiedenen Lokalausgaben letztlich gleiche Inhalte veröffentlicht würden.
Zwar sei es vorstellbar, dass gerade Lokaljournalisten tatsächlich über die Lage vor Ort insbesondere in der Corona-Krise berichteten, indem sie etwa in Krankenhäuser gingen und nachschauten, was dort wirklich an Krankheitsgeschehen los sei. Dabei gebe es allerdings das Problem, dass man als Journalist erst einmal Gesprächspartner vor Ort finden müsse, die bereit wären, ihnen eine Realität zu zeigen, die anders sei als das, was von den offiziellen Quellen aus Berlin berichtet werde. Hier sei an die Polizisten und Sportler zu erinnern, die die Corona-Politik kritisierten und dafür suspendiert beziehungsweise gekündigt worden seien.
Da muss man erst einmal den Klinikdirektor finden, der der Linie des Bundesgesundheitsministeriums widerspricht. In den meisten Fällen sind das Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, oder in Privatkliniken, die von bestimmten Geldflüssen abhängen. Das scheint auch da nicht so einfach zu sein, Menschen in Verantwortung zu finden, die dann in der Öffentlichkeit gegen den Strom schwimmen wollen.
Der Ausschuss bezweifelte das Ausmaß der Zustimmung in der Bevölkerung, wie es basierend auf Meinungsumfragen offiziell vermeldet werde. Eindrücken aus dem eigenen Umfeld zufolge misstrauten rund die Hälfte der Menschen dem gegenwärtigen Geschehen, könnten sich allerdings noch nicht entscheiden. Hier wäre also über unabhängige und breit angelegte Umfragen zu ermitteln, ob die offiziell genannte hohe Zustimmungsrate für die Corona-Politik tatsächlich real sei. Die Frage sei dann auch, ob die Leitmedien mangels eigener Berichterstattung vor Ort überhaupt noch mitbekämen, was in der Bevölkerung tatsächlich los sei.
Für Meyen ist dies Audruck einer Krise der Institutionen, auf die Wodarg am Anfang hingewiesen hat. Auch die empirische Sozialforschung, die Meinungsforschung befinde sich in einer Krise, wie man beispielsweise 2016 bei den Diskussionen um den Begriff “Lügenpresse” gesehen habe.
Viele Menschen, die nicht Medien an sich kritisieren, sondern Medien kritisieren, weil sie das System, in dem sie leben, kritisieren und der Politik nicht mehr glauben, die machen bei solchen Umfragen einfach nicht mehr mit. (…) Die reden auch nicht mit Journalisten. (…) Es ist nicht so einfach, dann Interviews mit Menschen zu bekommen, die sagen: ‘Das ist Lückenpresse oder Lügenpresse, mit dir rede ich einfach nicht.’ Insofern führt die Krise der Institutionen dann hier direkt zu Abbildern der Realität, die ihrem Gefühl, ihrem Bauchgefühl nicht mehr entsprechen.
Für Menschen, die einem gleich lautenden Medientenor zu “Abstand halten! Maske aufsetzen! Große Gefahr!” ausgesetzt seien, sei es schwer, sich in der Öffentlichkeit anders zu verhalten, da sie in den Leitmedien kaum Argumente fänden, die eine Gegenposition stützten.
Das kennen wir aus der Theorie der Schweigespirale. Wenn ich keine Argumente habe, die meine Position unterstützen, dann falle ich in Schweigen zurück, dann äußere ich mich nicht mehr. Das wurzelt in der Isolationsangst der Menschen, wo wir dann doch wieder bei der Psychologie wären. Ich möchte mich nicht isolieren. Ich sehe einen relativ einheitlichen Medientenor, also tue ich das, was dieser Medientenor von mir verlangt, weil ich sonst Sorge haben muss, dass mich meine Mitmenschen beschimpfen, auch wenn ich beispielsweise eine Maskenbefreiung hätte.
Das Problem der Distanz zwischen offizieller Politik sowie Leitmedien einerseits und der Bevölkerung andererseits werde zudem noch durch die Maßnahmen wie etwa das Maskentragen verschärft. Der öffentliche Raum der Zufallsbegegnungen und des Austausches jenseits meines Milieus sei durch die eingeschränkte sprachliche und mimische Kommunikation gestört, wenn nicht gar zerstört.
Dies führe auch zurück zum erwähnten Mediendruck, der auf die Politik wirke. Dort beobachte man die Medien und den öffentlichen Druck und gehe davon aus, dass die Wähler diese Berichte wahrgenommen haben, und reagiere entsprechend. Im Sinne der in der heutigen Mediengesellschaft unabdingbaren Legitimation durch Öffentlichkeit richte man das politische Handeln an positiver Berichterstattung aus.
Der Ausschuss erinnerte in diesem Zusammenhang an die Studie zur Beobachtung der Wirkungen und Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung. Dabei handelt es sich um ein “Gemeinschaftsprojekt von Universität Erfurt, Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation, Science Media Center, Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin und Yale Institute for Global Health”. Dies bestätigt das zuvor von ihm Gesagte hinsichtlich einer zu großen Nähe zwischen Politik, Medien und Wissenschaft, so Meyen.
Wenn Journalisten, genauso wie Wissenschaftler, sich in einer Art Verantwortung sehen – ich habe diesen Begriff Verantwortungsverschwörung vorhin hineingeworfen – und glauben, dass sie Zustimmung für Maßnahmen der Politik organisieren müssen, weil das irgendwie wichtig ist, dann haben wir ein Problem. Wenn Wissenschaftler nicht mehr analysieren und Journalisten nicht mehr das Gespräch der Gesellschaft vermitteln, sondern selber anfangen, Partei zu werden.
Hinzu kämen die ebenfalls bereits benannten und aus der Psychologie bekannten Aspekte solcher Nähe.
Kontakt schafft Sympathie. Wenn ich Leute permanent sehe. Wenn ich Einblicke erhalte, die wir als Normalbürger nicht bekommen, dann entwickle ich Verständnis. Und wenn ich Verständnis entwickle, dann lasse ich vielleicht Dinge der Wirklichkeit weg, die diesen Menschen, für die ich Verständnis habe, schaden könnten. Nähe ist ein Problem. Distanz wäre ein wichtiges Kriterium für Journalismus.
Was wiederum die Frage nach der Organisation des Journalismus berühre.
Wenn wir ein Mediensystem haben, das nach Aufmerksamkeit aufgebaut ist, was Exklusivnachrichten braucht, dann kauft sich Politik einfach auch Nähe über Exklusivnachrichten. Ich füttere dann bestimmte Journalisten mit Nachrichten, die die anderen nicht haben. Und kann mir auf diese Weise Wohlwollen bei dem nächsten Fall, wo ich vielleicht nicht so gut aussehe, organisieren.
Dieses Problem der Nähe und des Organisierens von Wohlwollen betreffe sowohl kommerzielle als auch öffentlich-rechtliche Medien. Allerdings sei dies für Letztere, die für sich selbst beanspruchten, unabhängig, distanziert, neutral und objektiv zu sein, weil sie öffentlich-rechtlich organisiert sind, umso bedenklicher.
Da habe ich eher ein Problem, weil ich diese Nähe dort nicht so leicht sehen kann.
Fortsetzung: Teil III folgt in Kürze
Mehr zum Thema – “Viren”, Masken, Tests, Impfungen – zur “neuen Normalität” in der Corona-Krise